Kolumbien verfügt über einen neuen Kompass für Entscheidungen zum Klimawandel: Er wird uns zeigen, wo es weniger regnen oder wo es heißer sein wird.

„Heute geben wir Kolumbien ein 100-Jahres-Vorausschau-Tool für faktenbasierte Planung.“ Mit dieser Aussage stellte das Institut für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien (IDEAM) vor wenigen Tagen die Departementsszenarien zum Klimawandel vor, einen Kompass, der wichtige Entscheidungen im Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels in den verschiedenen Regionen des Landes leiten kann.
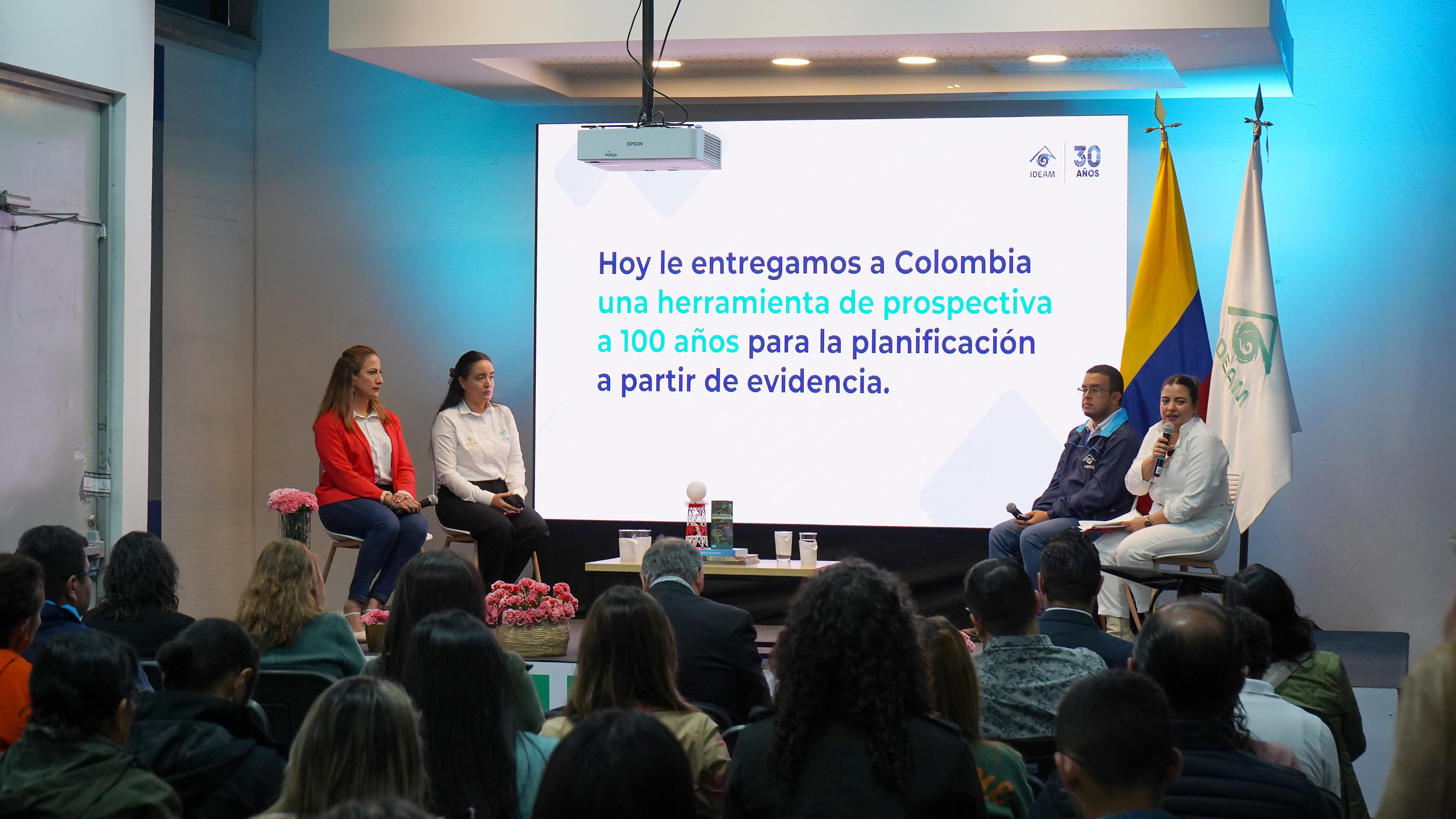
Präsentation der Klimaszenarien der einzelnen Abteilungen durch IDEAM. Foto: IDEAM
Diese Szenarien waren bereits auf nationaler Ebene, also für ganz Kolumbien, bekannt. Doch nun, mit der Aktualisierung der für Meteorologie und Klimastudien des Landes zuständigen Stelle , ist es möglich, bis ins kleinste Detail zu erfahren, wie sich das Klima in diesem Jahrhundert entwickeln könnte, insbesondere in den einzelnen Departements des Landes.
Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei diesen Instrumenten nicht um Prognosen handelt, sondern vielmehr um einen Input für die Entscheidungsfindung im Rahmen der Vierten Nationalen Mitteilung zum Klimawandel. Dabei handelt es sich um regelmäßige Berichte, die die Länder dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) vorlegen.
In diesem Sinne bieten diese Modelle eine Reihe von Szenarien, die es uns ermöglichen, mögliche Zukünfte unter verschiedenen globalen Entwicklungsverläufen vorherzusehen. Sie hängen stark von den Entscheidungen ab, die der Planet zur Bekämpfung des Klimawandels trifft, dienen aber auch als Orientierung dafür, was uns erwartet, wenn der Planet sich entscheidet, auch morgen noch fossile Brennstoffe zu verbrennen oder die CO2-Emissionen rasch zu reduzieren.
Wie funktionieren sie? Klimaszenarien sind wissenschaftlich erstellte Simulationen, die dabei helfen, sich vorzustellen, wie sich das Klima in Zukunft unter verschiedenen globalen und sozialen Bedingungen entwickeln könnte. Diese Szenarien basieren auf den sozioökonomischen Entwicklungspfaden (SSPs), den vom Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) entwickelten Projektionen. Diese gruppieren alternative Zukunftsszenarien, je nachdem, wie sich die Welt in Schlüsselaspekten wie internationaler Zusammenarbeit, Wirtschaftswachstum, Ungleichheit, Nutzung sauberer Energie und Konsummustern entwickelt.
Die Vierte Nationale Mitteilung verwendet vier dieser Szenarien: SSP1, SSP2, SSP3 und SSP5 (in ihren aktuellsten Versionen). Jedes dieser Szenarien stellt ein anderes Niveau der Treibhausgasemissionen und damit klimatische Folgen für den Planeten dar. SSP1 beispielsweise gilt als optimistisches Szenario: Es handelt sich im Wesentlichen um eine Partnerschaft mit starker globaler Zusammenarbeit, in der die Energiewende beschleunigt und die Emissionen drastisch reduziert werden, mit der Erwartung, die globale Erwärmung auf unter 2 °C zu begrenzen. Und obwohl es das einzige Szenario ist, das mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmt, ist dies nicht das aktuelle globale Szenario.
SSP2 hingegen entwirft eine Zwischenszenarie mit teilweise nachhaltiger Entwicklung, moderaten Fortschritten bei der Emissionsreduzierung und einer fragmentierten Klimapolitik. SSP3 beschreibt eine konfliktreichere Welt mit geopolitischen Spannungen, geringer Kooperation und stetig steigenden Emissionen. SSP5 ist das kritischste Szenario: eine hypertechnologisierte Gesellschaft, die weiterhin von fossilen Brennstoffen abhängig bleibt und keine Emissionskontrollen vorsieht, was zu einem deutlich schnelleren Anstieg der globalen Temperatur führen würde.
In diesem Sinne sind Klimaszenarien eine Art Kompass: ein Leitfaden, der auf der Grundlage der weltweiten Entwicklungen die wahrscheinliche Richtung aufzeigt, in die sich das Land bewegen würde. So können Politiker und Entscheidungsträger die notwendigen Strategien planen, um beispielsweise einem Temperaturanstieg von mehr als 4 °C oder einem Rückgang der Niederschläge um 30 % zu begegnen.
Szenarien liefern Daten zu verschiedenen Klimavariablen wie Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit und Häufigkeit extremer Ereignisse, projiziert über verschiedene Zeithorizonte . Dies ermöglicht die Analyse potenzieller Auswirkungen auf natürliche und menschliche Systeme wie Ernteerträge, Wasserversorgung, Infrastruktur, öffentliche Gesundheit und Ökosysteme.
„Es handelt sich um einen territorialen Zoom, der die Präzision der Analyse verbessert“, sagte IDEAM-Direktorin Ghisliane Echeverry in einem Interview mit EL TIEMPO. „Mit diesen Modellen können wir Jahr für Jahr und Quartal für Quartal mögliche Szenarien abbilden, nicht als einmalige Prognose, sondern als leistungsstarkes Instrument der Raumplanung.“

Ghisliane Echeverry Prieto, Direktorin von Ideam. Foto: Ideam
Eines der alarmierendsten Beispiele der Szenarien ist La Guajira. IDEAM prognostiziert dort einen Rückgang der Niederschläge um 10 bis 20 Prozent , verbunden mit einem Temperaturanstieg von 1,5 bis 2 Grad Celsius, je nach Szenario. „Das ist sehr ernst und besorgniserregend“, warnte Echeverry. „Das Departement ist bereits jetzt sehr trocken, und ein weiterer Rückgang der Niederschläge könnte dramatische Auswirkungen auf die Wassersicherheit, die Ökosysteme und die Gesundheit haben.“
Die Auswirkungen werden jedoch nicht im ganzen Land gleichmäßig sein. „Es gibt Departements, in denen die Niederschläge zunehmen könnten. Deshalb ist es für Entscheidungsträger so wichtig, Zugang zu diesen Informationen zu haben. Denn nicht alle werden gleichermaßen betroffen sein. Und die öffentliche Politik kann sich nicht an nationalen Durchschnittswerten orientieren“, betont der Beamte.
Die Direktorin hinterfragte auch historische Entscheidungen zur Wasserplanung, die nun durch die neuen Szenarien gefährdet seien. „Alle Stauseen konzentrieren sich in der Andenregion, wo es die gleichen Niederschlagsmuster gibt. Kommt es dort jedoch zu Wassermangel, bricht das gesamte System zusammen. Gleichzeitig fehlt es in Regionen wie dem Pazifik, wo es reichlich regnet, an der Infrastruktur zur Wasserspeicherung“, warnt sie.
Der größte Wert dieser Szenarien liege laut Echeverry in ihrer Möglichkeit, vorausschauend zu handeln. „Es geht hier nicht um Panikmache. Es geht darum, strategische Entscheidungen zu treffen. Wo baue ich ein Reservoir? Wo ist der Anbau einer bestimmten Nutzpflanze nicht sinnvoll? Wie passe ich die Infrastruktur an extreme Hitze oder Starkregen an? All das lässt sich mit diesen Informationen besser planen“, fügt er hinzu.
„Das Wasser der Zukunft ist nicht das Wasser von heute“ Für Diego Restrepo Zambrano, einen Experten für Wasserwissenschaften und Klimaanpassung, besteht einer der wichtigsten Punkte der aktualisierten Szenarien darin, dass wir nun bessere Entscheidungen in Bezug auf Wasser treffen können, um Probleme wie das zu vermeiden, das zwischen 2024 und 2025 in Bogotá aufgrund der Rationierung auftrat.

Die Stauseen Bogotás waren im Jahr 2024 durch geringe Niederschläge beeinträchtigt. Foto: El Tiempo
„Das ist für Kommunen von entscheidender Bedeutung, da sie ihre Gebiete besser verwalten und dabei sowohl Risiken als auch Fragen der Wasserversorgung berücksichtigen können“, so Restrepo. Lokale Klimainformationen, so Restrepo, würden es ihnen ermöglichen, wichtige Fragen zu beantworten, etwa: „Wo regnet es mehr, wo regnet es weniger, wo steigen die Temperaturen, wo besteht eine klimabedingte Gefährdung der Ökosysteme.“
Er warnt jedoch davor, dass noch ein tiefgreifender institutioneller Wandel nötig sei, damit diese Informationen konkrete Auswirkungen auf die öffentliche Politik haben: „Wir brauchen eine neue Politik, die den Klimawandel in die Planungsinstrumente einbezieht … Wir verfügen heute über viele Planungsinstrumente, aber keines davon berücksichtigt den Klimawandel, keines davon berücksichtigt die Risiken, die mit abnehmenden oder zunehmenden Niederschlägen einhergehen.“
Um diese Dringlichkeit zu verdeutlichen, betont Restrepo die Bedeutung von Wassereinzugsgebieten und Feuchtgebieten als natürliche Anpassungsstrategien. „Sie werden dort noch wichtiger, wo es mehr Niederschläge und damit ein höheres Überschwemmungsrisiko gibt. Diese Ökosysteme können dazu beitragen, das Hochwasserrisiko in Zukunft zu verringern, und genau darum geht es bei der Anpassung an den Klimawandel“, betont er. Damit dies jedoch gelingt, so Restrepo, „muss sich die öffentliche Politik auf die Bemühungen von IDEAM zur Entwicklung dieser Szenarien konzentrieren, damit sie in Planungsinstrumente einbezogen werden können.“
Was fehlt Für Benjamín Quesada, Klimatologe und Leiter des Bachelorstudiengangs Erdsystemwissenschaften an der Universidad del Rosario, stellen diese neuen Klimaszenarien zwar erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Ausgaben dar – die Dritte Nationale Mitteilung zum Klimawandel wurde 2015 vorgestellt, und in den darauffolgenden Jahren wurden weitere Beiträge veröffentlicht. Dennoch fehlen noch viele Informationen, die das Land braucht, um sich besser vorzubereiten.
„Diese Ausgabe legt mehr Wert auf Transparenz, insbesondere auf methodischer Ebene und durch die Möglichkeit, Basisdaten herunterzuladen, sowie auf der Verbreitungsebene, um Entscheidungsträgern geografisch aufgeschlüsselte Informationen für verschiedene relevante Klimavariablen zu bieten“, erklärt Quesada. Neben seinem technischen Wert ermöglicht das IDEAM-Geoportal auch den offenen Download von Prognosedaten und die Simulation von Entwicklungsverläufen mit höheren oder niedrigeren Emissionen. Dies, so Quesada, „kann Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen steuern und dazu beitragen, Investitionen entsprechend dem lokalen Kontext zu priorisieren.“
Der Experte stellt jedoch klar, dass das Modell noch „erheblichen Verbesserungsbedarf“ habe, um wirklich optimale territoriale Planungs- und Anpassungsfähigkeiten zu erreichen. Zunächst kritisiert er „die begrenzte Beteiligung von Wissenschaft und Peer-Review“ an der technischen Konstruktion der Szenarien. Hinzu kämen „das Fehlen von Ozeanprojektionen, die mangelnde Kommunikation über potenzielle Unsicherheiten oder die Robustheit zwischen Modellen in bestimmten Abteilungen und das Fehlen physikalischer Erklärungen für die prognostizierten Veränderungen im Vergleich zur bestehenden Literatur und/oder früheren IDEAM-Ausgaben“. Für Quesada erfordert das Schließen dieser Lücken eine stärkere wissenschaftliche und institutionelle Zusammenarbeit: „All dies erfordert mehr kollaborative Forschung.“
Der Schlüssel zu den Daten liege letztlich darin, Lösungen zu entwickeln, so der Klimaforscher, und zwar in Zusammenarbeit mit den am stärksten gefährdeten Gemeinschaften, die letztlich am stärksten vom Klima betroffen seien. „Gemeinsam mit den lokalen Gemeinschaften, insbesondere den gefährdeten Gemeinschaften, einschließlich der indigenen oder vertriebenen Bevölkerung, müssen wir Maßnahmen entwickeln, die ihren sozialen und kulturellen Bedürfnissen gerecht werden, wie etwa Agroforstwirtschaft zum Schutz tropischer Trockenwälder und die Priorisierung von Wasserressourcen für lebenswichtige statt für industrielle Zwecke“, so sein Fazit.
Umwelt- und Gesundheitsjournalist
eltiempo





