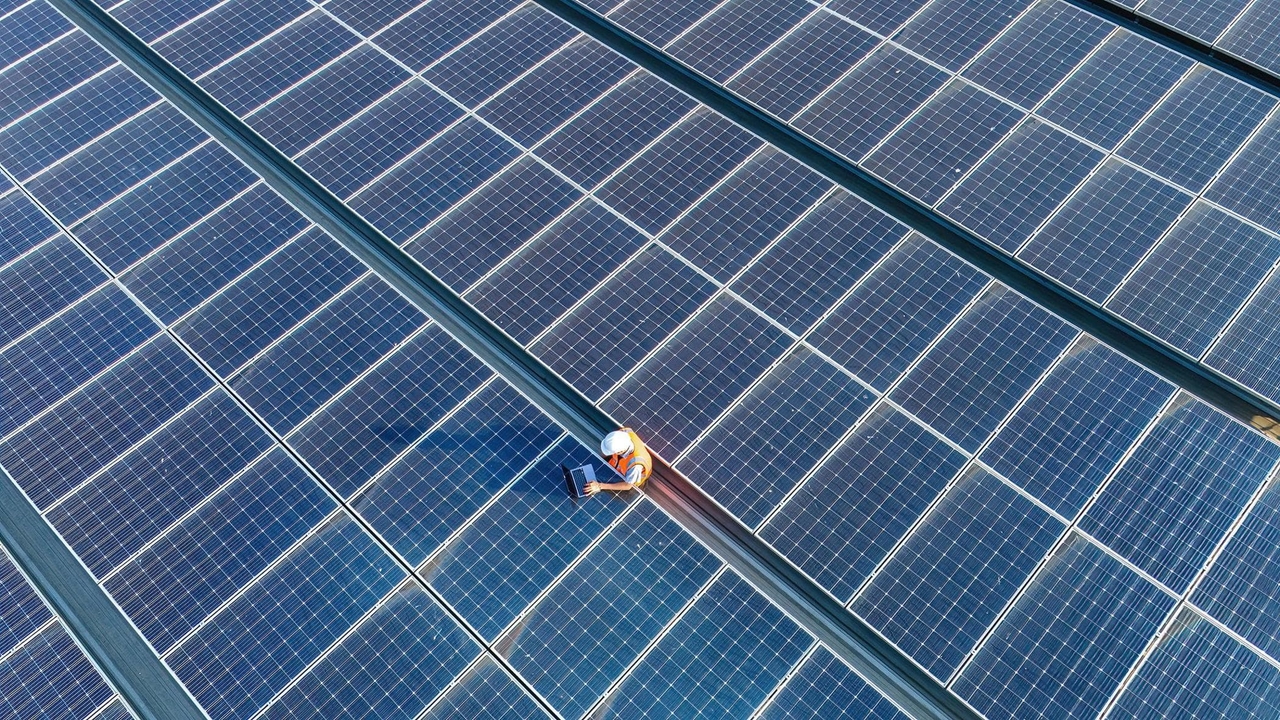Klima: Fossile Brennstoffe auch 2030 noch über den Grenzwerten

Zehn Jahre nach dem Pariser Abkommen vergrößert sich die Kluft zwischen den Klimaverpflichtungen der Regierungen und der Realität ihrer Energiepläne weiter. Dies geht aus dem Production Gap Report 2025 hervor, der am 22. September vom Stockholm Environment Institute (SEI), dem Internationalen Institut für nachhaltige Entwicklung (IISD) und Climate Analytics vorgestellt wurde. Der Bericht, der mittlerweile in der fünften Ausgabe vorliegt, verdeutlicht einen strukturellen Widerspruch: Während die internationale Gemeinschaft die Notwendigkeit bekräftigt, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, planen die Regierungen eine Steigerung der Kohle-, Öl- und Gasproduktion , die die Welt in die entgegengesetzte Richtung treibt.
Das Schlüsselkonzept ist die Produktionslücke , d. h. die Differenz zwischen den Mengen fossiler Brennstoffe, die die Länder fördern wollen, und den Mengen, die mit den Pariser Klimazielen vereinbar sind. Bis 2030 werden die Regierungspläne zu einer Produktion fossiler Brennstoffe führen, die 120 % über dem mit 1,5 °C vereinbaren Niveau und 77 % über dem mit 2 °C vereinbaren Niveau liegt . Dies ist eine Verschlechterung gegenüber 2023, als die Lücke bereits 110 % bzw. 69 % betrug. Die Analyse zeigt, dass die Regierungen insgesamt bis 2035 mehr Kohle und bis 2050 mehr Gas fördern und die Ölförderung im Laufe des Jahrhunderts weiter steigern wollen. Den Szenarien des Berichts zufolge würde die prognostizierte weltweite Produktion im Jahr 2030 bei Kohle um 500 %, bei Gas um 92 % und bei Öl um 31 % höher sein als die mit 1,5 °C vereinbaren Mengen.
Der kritische Punkt ist, dass diese Pläne mit den Prognosen internationaler Energieszenarien kollidieren. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass die weltweite Nachfrage nach Kohle, Öl und Gas vor 2030 ihren Höhepunkt erreichen wird. Die Regierungen konzentrieren sich jedoch weiterhin auf neue Produktions- und Infrastrukturen für fossile Brennstoffe, wodurch ein „Lock-in-Effekt“ entsteht, der eine Trendumkehr in Zukunft schwieriger und kostspieliger machen wird . Der Bericht hebt zwei Konsequenzen hervor. Die erste ist, dass die kumulierte Produktion fossiler Brennstoffe in den Jahren 2020 bis 2029 viel höher sein wird, als es die Klimapfade zulassen. Die zweite ist, dass, genau um diesen Überschuss auszugleichen, die Kürzungen in Zukunft schneller und schmerzhafter ausfallen müssen. Um das Ziel der Klimaneutralität in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu erreichen, wird es notwendig sein, die Produktion fossiler Brennstoffe auf das geringstmögliche Niveau zu reduzieren: nahezu null Kohle bis 2040 und eine Reduzierung von Öl und Gas um etwa drei Viertel bis 2050 im Vergleich zu 2020.

Einige Förderländer haben bereits Maßnahmen ergriffen. Kolumbien hat einen Fahrplan für eine gerechte Energiewende verabschiedet, Deutschland hat den Kohleausstieg vorweggenommen, Brasilien hat ein Programm zur Beschleunigung der Energiewende gestartet und China hat sein Ziel für erneuerbare Solar- und Windkraftkapazitäten bis 2030 bereits sechs Jahre früher als geplant erreicht. Die meisten Regierungen richten ihre Produktionspläne jedoch nicht an den Klimazielen aus und unterstützen die fossile Brennstoffindustrie weiterhin mit direkten oder indirekten Subventionen. Im Jahr 2024 lag die öffentliche Unterstützung für fossile Brennstoffe nahe einem Allzeithoch.

Der Bericht analysierte detailliert die Pläne von 20 großen Produzenten – von den USA über China und Russland bis hin zu Saudi-Arabien. Ganze 17 der 20 Länder planen, die Produktion mindestens eines fossilen Brennstoffs bis 2030 zu steigern, und 13 erwarten ein starkes Wachstum bei Gas. In einigen Fällen – wie etwa in den USA, Russland und Saudi-Arabien – liegen die Prognosen sogar über den Prognosen für 2023. Das Fazit ist eindeutig: Wenn Regierungen die Reduzierung der Produktion fossiler Brennstoffe nicht explizit in ihre Energiewendepläne integrieren, bleibt jedes Klimaziel unerreichbar. Daher ruft der Bericht im Vorfeld der dritten Runde der nationalen Beiträge (NDCs) zum Pariser Abkommen zu einer Umkehr des Ausbaus fossiler Brennstoffe und einer Stärkung der internationalen Zusammenarbeit für eine gerechte globale Energiewende auf. Das Zeitfenster, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, schließt sich rapide.
La Repubblica