Wie viele Salazars brauchen wir wirklich?
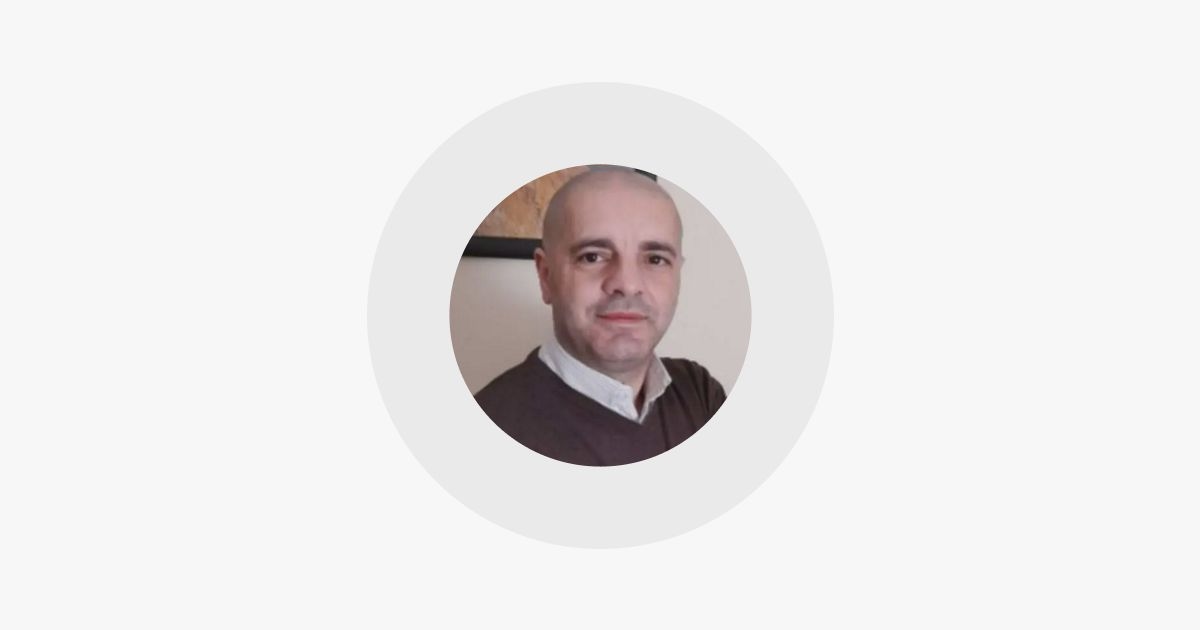
1. Evolution und Genetik, in ihrer neodarwinistischen Auslegung, zusammen mit einem vermeintlichen freien Willen, bestimmten, dass ich genau eine Woche vor dem 25. April geboren wurde. Daher entgingen mir die Ereignisse vor und nach diesem Datum völlig. Ich erlitt weder die Härten des Regimes noch ritt ich auf der revolutionären Welle der folgenden Jahre. Ich wurde unpolitisch geboren. Heute, im Rückblick, würde ich sagen, dass ich frei geboren wurde. Eine Freiheit a priori , in der man in Unwissenheit über vergangene Fehler und rhetorische Tricks lebt, befreit von der ewigen und entscheidenden Frage: Wo warst du am 25. April?
Ich bin in der Provinz geboren. In einer Stadt, die zu nah an Porto lag, um die Unabhängigkeit zu erlangen, und zu weit von der Hauptstadt entfernt, um Bedeutung zu haben. Soweit ich gehört habe, erreichten die Umbrüche des PREC (Processo Revolucionário em Curso – Laufender Revolutionsprozess) sie nicht. Bärtige Soldaten und Waffen blieben fremd und störten die natürliche Apathie der Einwohner Gondomars nicht. Weder zu Hause noch in der Schule wurden die Emotionen und Umbrüche jener Zeit erwähnt. Salazar, Cunhal und Marx blieben im Schatten meiner schulischen Ausbildung und, als natürliche Folge meiner Herkunft aus einer unpolitischen Familie, anonym. Erst viel später begann ich, mich autodidaktisch mit politischen Themen auseinanderzusetzen.
Mir wurde klar, dass man reich geboren sein und die Armen verteidigen kann, oder arm geboren sein und die Reichen verteidigen. Zumindest wurde es so in den Medien dargestellt, und tatsächlich wagte es niemand, dem zu widersprechen. Dieser Kampf schien mir unaufhaltsam, und da ich aus einer Familie der Mittelschicht stammte, freute ich mich, dass mir Menschen aus besseren Verhältnissen Gehör schenkten. Es schien klar, dass auf der einen Seite die Guten und auf der anderen die Bösen standen. Sich als interklassenbewusst zu bezeichnen, klang für mich, als würde man sich neutral verhalten – und das war, ganz klar, verwerflich.
Erst Jahre später fragte ich mich: Wo ist die Rechte? Denn es war offensichtlich, dass es weder eine Partei noch eine Bewegung noch eine Einzelperson gab, die sich diesem Teil des politischen Spektrums zugehörig fühlte oder sich darin wiederfand. Man musste in die Vergangenheit zurückblicken, in die historische Vergangenheit, in eine andere Welt aus einer anderen Ära, man könnte sagen, aus dem Jura, um einen Blick auf ihr Profil zu erhaschen. Niemand konnte in der Gegenwart für sie sprechen. Es blieb ein bitterer Nachgeschmack, wenn man versuchte, etwas darüber zu hören oder zu lesen; zu viele Zurückhaltungen, Intrigen hinter den Kulissen und Ausreden. Die wohlwollendsten und großzügigsten lächelten gequält, wenn es um das Thema ging; die pessimistischsten schleuderten Beleidigungen – aber alle mieden es.
Auf institutioneller und parteipolitischer Ebene, insbesondere innerhalb eines bestimmten linken Flügels, wurden diejenigen, die eine besonders unbequeme Position oder Persönlichkeit angreifen wollten, als Salazar-Anhänger oder Reaktionäre beschimpft. Nicht viel mehr.
So befanden wir uns in einem Schwebezustand aus Verleumdung und schlechtem Ruf, durchzogen von Boshaftigkeit. Es gab keinen Zweifel: Der Estado Novo war böse. Diese Vorstellung wurde während der Gedenkfeiern zur Gründung des Regimes bestärkt und weiter offengelegt, einer Zeit, in der die Wunden sichtbar wurden und die Rufe der Empörung lauter wurden. Dort traten Folter, Gewalt, die PIDE (Geheimpolizei), Zensur – Faschismus – in Erscheinung. Doch über die Doktrin, Ideologie, Axiologie und Herrschaft des Salazarismus herrschte ein beunruhigendes Schweigen. War es Angst, fragte ich mich.
Es dauerte Jahrzehnte, bis sich der Schleier langsam lüftete. Die Wiederbelebung der CDS als PP von Manuel Monteiro und Paulo Portas, einige Publikationen, Titel und Autoren waren aus Angst vor Zensur weiterhin rar. Jeder, der es wagte, sich öffentlich zu äußern, wurde als Faschist beschimpft. Das Land war politisch verrottet, mit allen damit verbundenen zivilen Folgen. Ein bedeutender Teil der portugiesischen Bevölkerung wurde zum Schweigen gebracht. Themen, Probleme, Programme und Ideen wurden einfach unterdrückt, weil sie nicht auf der richtigen Seite der Geschichte standen.
2. Salazar, ein Professor in Coimbra, der aus katholischer Perspektive in die Politik eingeführt wurde, verstand sich als Zentrist. Die christliche Demokratie in der Auslegung Leos XIII. prägte seine Doktrin. Nach seiner Machtergreifung schwenkte er aufgrund der Einmischung radikaler militärischer und ideologischer Gruppierungen, sowohl linker als auch rechter, aus rein machiavellistischen Gründen – dem Machterhalt – nach rechts. Angeklagt und umzingelt von einer integralistischen und nationalsyndikalistischen Rechten einerseits und liberalen Republikanern andererseits, war er bald gezwungen, sich durch ein Labyrinth von Intrigen und Fallen zu manövrieren. Obwohl er heute wie ein absoluter Herrscher wirkt, zeigte er in Wahrheit erst relativ spät Anzeichen dafür, die politische Landschaft angemessen zu beherrschen.
In seiner frühen Karriere wurde er von der radikalen Rechten angegriffen, die ihn als „weißen Bolschewiken“ diffamierte und ihn damit in die Kategorie des verwerflichsten Begriffs ihres politischen Vokabulars einordnete. Von Natur aus pessimistisch und aufgrund seines Misstrauens gegenüber dem Volk und dem Pathos der Massen abgeneigt, verschrieb er sich nie dem Faschismus und seiner gewalttätigen, revolutionären und futuristischen Bewegung. Vor allem war er Konservativer, genauer gesagt katholischer Konservativer. Reaktionär wäre ebenfalls eine treffende Bezeichnung. Neben seinem Misstrauen war er zurückhaltend, friedliebend und familienorientiert. Eher spartanisch als bescheiden, rühmte er sich seiner akademischen Fähigkeiten und Erfolge aus Coimbra. Er entwickelte einen einzigartigen Autoritarismus, basierend auf der portugiesischen Geschichte und dem portugiesischen Glauben, und verlieh der undemokratischen nationalen Rechten damit eine theoretische Grundlage.
In dieser genuin portugiesischen Weltsicht, die Internationalismus und ideologischen Abenteuern gänzlich ablehnte, gründete Salazar seine Macht und seine Doktrin. Eine Doktrin mit der nötigen Flexibilität, um die Auswirkungen der internationalen Bühne abzumildern, zunächst im Zweiten Weltkrieg und später in den Unabhängigkeitskämpfen der Kolonien.
Anders als faschistische und kommunistische totalitäre Regime legte der Staatsmann von Vimieiro stets Wert auf die Wahrung der Privatsphäre und des Gewissens seiner Bürger. Er gewährte ihnen zwar keine politischen Freiheiten, tolerierte aber verschiedene Formen des Widerspruchs. Zwar reagierte er in einigen Fällen mit Verbannung, doch maß er ihnen meist keine allzu große Bedeutung bei und verwehrte ihnen stattdessen den Zugang zur Macht. Es gab keine Massengräber, und obwohl die Bedingungen in Tarrafal hart und unhygienisch waren, waren weder die Anzahl der Verurteilten noch die Strafen mit denen der Gulags vergleichbar.
Tatsächlich können seine linken Gegner, während sie jene Jahre und ihre Verfolgungspraktiken heute ungehemmt anprangern, höchstens einen zaghaften Versuch unternehmen, sogar zu Attentaten zu greifen. Solche Aktionen sind selbstverständlich zu verurteilen; vergleicht man sie jedoch – und man muss sie vergleichen – mit der Folter und den Morden Lenins, Stalins und, zumindest nach Trotzkis ausdrücklichem Willen, auch Othellos und seiner Gefolgschaft, so erscheinen sie als letztes Mittel. Selbst als sich die Beziehungen zur Kirche von Cerejeira abkühlten, erlaubten ihm seine katholische Überzeugung und sein Glaube nicht, die Macht, die er inzwischen an der Spitze der Geschicke des Landes erlangt hatte, rücksichtslos zu missbrauchen. Seine politische und moralische Flexibilität erlaubte ihm jedoch keinen Waffenstillstand gegenüber Kommunisten und dem Kommunismus. Als größte Gefahr für das Regime und die Nation auserkoren, zwang ihn seine Predigt von Gott, Vaterland und Familie, den Marxismus als politisches und ethisches Gräuel zu betrachten.
In mehreren ausländischen Publikationen wurde er damals als moralischer Diktator beschrieben, als Staatsmann, der nur Zahlen und Gott kannte.
3. Das Thema weckt offensichtlich Emotionen. Schließlich: Wie viele Salazars braucht Portugal? Oder, etwas nüchterner formuliert: Braucht das Land überhaupt einen Salazar? Und wozu, mit welchem Ziel?
Die Kontroverse entzündete sich an einer Antwort des Chega-Vorsitzenden André Ventura in einem Interview und einer anschließenden Gegendarstellung im Parlament. Darin bezog er sich erneut auf die Korruption im Land und soll dabei – angeblich in dreifacher Ausprägung – auf den ehemaligen Premierminister angespielt haben. Das politische Establishment und seine Kommentatoren reagierten empört, und es wurden erneut Rufe nach der Auflösung der Partei laut. Prata Roque, García Pereira und andere Persönlichkeiten des mehr oder weniger radikalen linken Spektrums verurteilten die offen faschistischen Äußerungen öffentlich und vor dem Verfassungsgericht. Abgerundet wurde das Szenario durch die kürzlich im ganzen Land aufgehängten Plakate. Ich werde diese in diesem Artikel nicht weiter erwähnen.
(André Ventura hat, wie ich selbst, die Härten des Salazarismus nicht erlebt. Wenn jedoch jemand auf die widersprüchliche Situation hinweist, dass er unter dem Estado-Novo-Regime solche Kommentare nicht frei in Plenarsitzungen oder im Fernsehen äußern konnte, ihm also die Freiheit dazu fehlte, dann entsteht meiner Ansicht nach ein Widerspruch. Die Nationale Union würde Venturas geäußerten Wunsch sicherlich begrüßen. Abgesehen davon, dass sie das nationalsozialistische und bolschewistische Konzept eines Einparteiensystems nicht teilt, würde diese Organisation Venturas Predigten als politisch normal ansehen.)
Die angeführte Verfassungsnorm, die den empörten Moralvorstellungen und der vermeintlichen Reinheit bestimmter ideologischer Strömungen nicht gerecht wird, ist auf eine politisch voreingenommene Verfassung zurückzuführen: Sie verurteilt zwar den Faschismus, duldet aber verschiedene Formen des Kommunismus. Der Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft , ein unverkennbares Zeichen einer langen Vergangenheit der Rechten und einer harten, autoritären Rechten, vor allem aber aufgrund der Sympathie, des Kampfgeistes, der Passivität und der Nachgiebigkeit der Aprilkapitäne und eines bedeutenden Teils des Außenministeriums (sowie der Komplizenschaft vieler Politiker), bedingte die Demokratie und ihr Regime vollständig, zudem mit den bekannten Schwierigkeiten und Hindernissen behaftet. Heute ist es für jeden auch nur halbwegs neutralen und unvoreingenommenen Betrachter offensichtlich, dass die Aufständischen des Staatsstreichs und später viele von ihnen, die Revolutionäre während des PREC (Processo Revolucionário em Curso – Laufender Revolutionsprozess), für Portugal niemals eine Demokratie im westlichen Sinne, also eine liberale Demokratie, anstrebten. Mit anderen Worten, sie waren antidemokratisch (und griffen Jahre später sogar zum unverfälschten Terrorismus).
Man kann und sollte das Image der extremen Linken nicht reinwaschen und gleichzeitig die (vermeintliche) extreme Rechte verurteilen und herabsetzen. Vor nicht allzu langer Zeit legte der damalige Vorsitzende des Linksblocks, Francisco Louçã, die parlamentarische Arbeit lahm, weil ihm kein Sitz im linken Flügel der PCP (Portugiesische Kommunistische Partei) gewährt wurde. Der Ökonom erklärte damals stolz, er gehöre dem extremen linken Spektrum an und verorte sich dort. Seine ideologischen Vorbilder waren alles andere als mittelalterliche Heilige und Ritter. Diese Ungleichbehandlung trat in dieser Kontroverse deutlich zutage, die zudem von Chegas erbittertsten Gegnern angeheizt wurde. Für Ventura scheint es eine Art Bestimmung zu sein, für Ausgewogenheit zu sorgen. Dies ist für bestimmte Ideologien, die es gewohnt sind, den öffentlichen und medialen Raum zu dominieren, sehr schwierig.
Ventura mag sich mit einem vermeintlich populären und vertrauten Spruch aus seiner Jugendzeit absichern. Fest steht: Angesichts seines jungen Alters ist er kein nostalgischer Mensch . Was wollte er damit sagen, was bedeutet der verwendete Ausdruck? Nur er selbst wird es wissen. Man könnte seine Worte als Teil des Wahlkampfes vor den Präsidentschaftswahlen deuten, als Versuch, die Wählerschaft aufzurütteln und die Anhänger zu mobilisieren. Oder einfach nur, um Aufmerksamkeit zu erregen – eine für den Anführer von Chega durchaus übliche Taktik. Ob dies der beste oder richtige Weg ist, wirft natürlich ernsthafte Zweifel auf.
Geschichte und Politikwissenschaft beschäftigen sich mit Salazar. Wir, seine Zeitgenossen, die die Vergangenheit kennen, müssen uns im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit der Gegenwart widmen. Eine Rückkehr zu Salazar und dem Salazarismus ist nicht nur unmöglich, sondern absurd. Zeiten und Land sind andere, die politischen Akteure und Bürger sind andere. Die Welt hat sich verändert. Wir leben in einer Demokratie (einer liberalen Variante) und müssen in der Demokratie bleiben. Das Regime kennt jedoch mehrere Varianten und verfügt über diese, sowohl praktisch als auch institutionell. Jedes Volk hat das Recht, selbst zu wählen. Dafür sind Wahlen da: frei und fair, um den Willen des Volkes widerzuspiegeln. Hinterzimmerwahlen, derer das vorherige Regime zu Recht beschuldigt wird, sind unzulässig.
Um die Frage direkt zu beantworten: Portugal und das portugiesische Volk brauchen keinen Salazar. Sie brauchen eine moderne und furchtlose Führungspersönlichkeit, die den aktuellen Herausforderungen entschlossen begegnet. Aber das ist ein Klischee.
observador



