Warum reden wir mit uns selbst?

Wer schon einmal einem kleinen Kind beim Spielen zugesehen hat, wird bemerkt haben, dass es Sätze darüber murmelt, was es tut oder denkt: „Jetzt werde ich dieses Haus bauen“, „Das Baby geht schlafen, weil es müde ist“, „Pass auf, der Drache kommt.“ Das Kind spricht mit niemandem, oder besser gesagt: Es spricht mit sich selbst.
Dieses Verhalten wurde erstmals von Lew Wygotski beobachtet, einem russischen Psychologen, der in den 1920er Jahren Kinder studierte und zu dem Schluss kam, dass diese Art der Sprache ein wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses ist, da sie es dem Kind ermöglicht, seine Gedanken zu ordnen, sein Verhalten zu regulieren und wahrscheinlich die Sprache, die es noch lernt, als Werkzeug zur Planung und Problemlösung zu verinnerlichen.
Und obwohl es uns als Erwachsene vielleicht peinlich ist, es zuzugeben – oder wir uns schämen, wenn wir erwischt werden – führen die meisten von uns weiterhin Selbstgespräche, manchmal laut, manchmal nur in unserem Kopf. Es handelt sich um ein sehr verbreitetes Verhalten, das Psychologen und Forscher auf diesem Gebiet als Selbstgespräch oder Selbstdialog bezeichnen, der in privates Sprechen (wenn wir laut mit uns selbst sprechen) und inneres Sprechen (wenn wir nur in Gedanken mit uns selbst sprechen) unterteilt werden kann.
„Menschen führen aus den unterschiedlichsten Gründen Selbstgespräche. Zum Beispiel, um ein Problem zu bewältigen, sich selbst zu motivieren, neue Ideen zu entwickeln oder soziale Interaktionen zu üben“, erklärt Charles Fernyhough, Leiter des Centre for Research into Inner Experience an der Durham University im Vereinigten Königreich und Autor des Buches The Voices Within . Laut dem Forscher zeigen Studien, dass diese Art der Sprache in der Kindheit von Vorteil ist, da sie Kindern hilft, Probleme zu lösen und ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Auch wenn es weniger Forschung zu diesem Thema bei Erwachsenen gibt, gibt es Grund zu der Annahme, dass sie einige der gleichen positiven Auswirkungen hat.
Obwohl es schwierig ist, dieses Phänomen zu quantifizieren, deuten einige Studien darauf hin, dass 96 % der Erwachsenen diese inneren Dialoge führen, während 25 % sagen, dass sie laut mit sich selbst sprechen . „Es ist bekannt, dass Kinder eher dazu neigen, laut mit sich selbst zu sprechen, und Erwachsene dies eher schweigend tun, dass sie unter schwierigen Bedingungen jedoch auch auf privates Sprechen [laut] zurückgreifen können.“
Das kann Ihnen Thomas Brinthaupt , emeritierter Professor an der Middle Tennessee State University in den USA, sagen, wo er in den Bereichen Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie und Identitätspsychologie forscht. Er erinnert sich, dass ihm das laute Selbstgespräch zum ersten Mal auffiel, als er vor über 30 Jahren Vater wurde und mit Schlafmangel zu kämpfen hatte. Dies führte ihn zu diesem Forschungsgebiet, um zu versuchen, die Frage zu beantworten: „Was ist letztlich die Funktion des Selbstgesprächs?“
Drei Jahrzehnte und Dutzende Studien zu diesem Thema später gelingt es ihm, die Antwort auf diese Frage in einem überraschend einfachen Satz zusammenzufassen: „ Es gibt wahrscheinlich genauso viele Gründe, mit sich selbst zu sprechen, wie mit anderen Menschen “, beginnt er mit seiner Antwort. Trotzdem habe die Forschung gezeigt, sagt er, dass „ eine der häufigsten Funktionen die Selbstregulierung ist , also der Versuch, unsere Gedanken und unser Verhalten zu kontrollieren oder anzupassen.“
Die Self-Talk Scale (STS) , eine von ihm entwickelte Skala zur Messung und Identifizierung der verschiedenen Arten von Selbstgesprächen, identifiziert auch andere Funktionen, „wie Selbstkritik (zum Beispiel, wenn wir mit uns selbst unzufrieden sind), Selbstverstärkung (d. h., wenn wir mit uns selbst zufrieden sind), Selbstmanagement (nämlich der Versuch herauszufinden, was wir tun müssen) und soziale Bewertung (wie das Vorwegnehmen oder Wiederholen sozialer Interaktionen).“ Es gibt auch andere Skalen und Studien, die von anderen Autoren entwickelt wurden und sich ebenfalls auf die Funktionen des Selbstgesprächs beziehen, wie etwa den Versuch , sich Informationen einzuprägen oder abzurufen, die Perspektive auf eine Situation oder ein Problem zu ändern und bereits mit anderen Menschen geführte Gespräche noch einmal zu erleben .
Was die Tatsache betrifft, dass wir diese Gespräche meist nur in unserem Kopf führen, ohne laut zu sprechen, betont Thomas Brinthaupt, dass es zwar wenig Forschung zu diesem Thema gibt, einer der Gründe jedoch in sozialer Hemmung liege. Das heißt, die Leute schämen sich, wenn sie dabei erwischt werden, wie sie mit sich selbst sprechen, weil sie dies mit Vorstellungen wie Verrücktheit oder psychischen Problemen in Verbindung bringen . Aus diesem Grund neigen wir im Allgemeinen dazu, lautes Selbstgespräch auf Situationen zu beschränken, in denen es gesellschaftlich akzeptabel ist. „Wie wenn ein Sprecher sagt: ‚OK, wo war ich stehen geblieben?‘; wenn jemand versucht herauszufinden, was mit seinem Computer nicht stimmt und fragt: ‚Warum funktioniert das nicht?‘ oder wenn Sportler versuchen, sich während eines Wettkampfs zu motivieren oder zu fokussieren, indem sie beispielsweise sagen: „Du schaffst das!“
Und obwohl es stimmt, dass Selbstgespräche, insbesondere wenn sie ungeordnet oder unzusammenhängend sind, manchmal ein Symptom einer psychischen Störung sein können, handelt es sich dabei meistens nur um einen normalen, sehr verbreiteten und gesunden Weg, unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu verarbeiten und zu ordnen.
„Mental“ ist ein Abschnitt des Observador, der sich ausschließlich Themen im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit widmet. Es ist das Ergebnis einer Partnerschaft mit dem Hospital da Luz und Johnson & Johnson Innovative Medicine und wird in Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Fakultät der portugiesischen Ärztekammer und der portugiesischen Psychologenkammer durchgeführt. Es handelt sich um völlig unabhängige redaktionelle Inhalte.
Eine Partnerschaft mit:


In Zusammenarbeit mit:
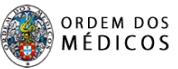

observador





