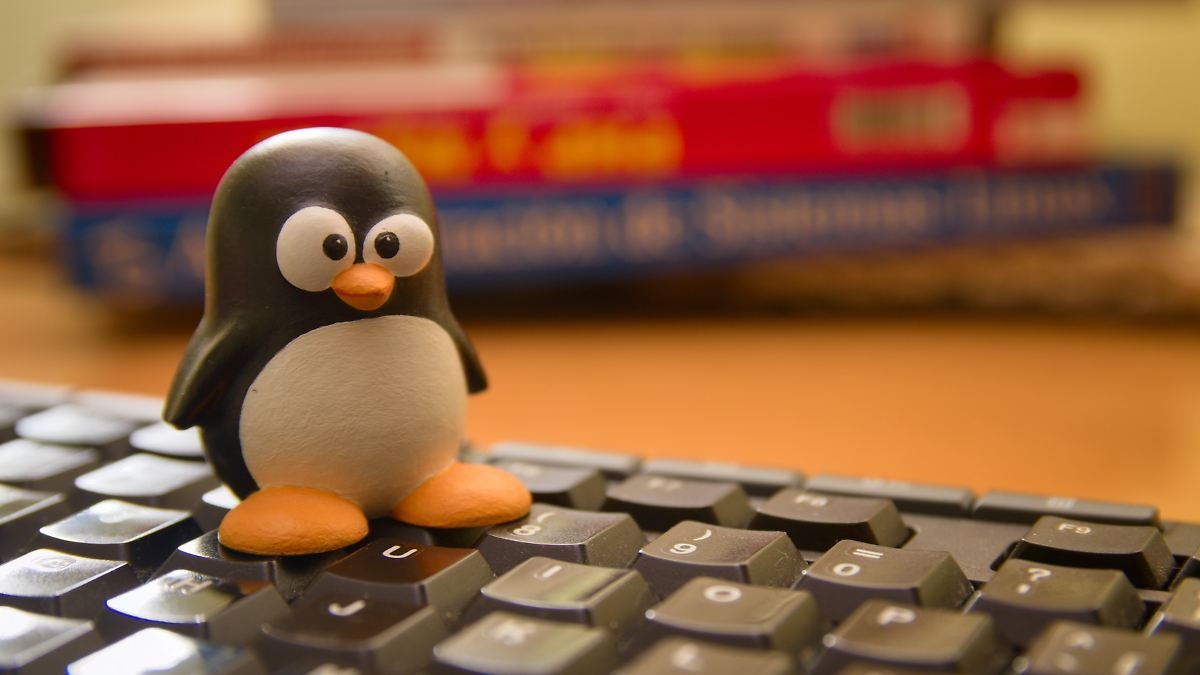Bergsturz in der Schweiz: Kleines Nesthorn bedroht Blatten – Gefahr wächst durch Klimawandel

Das Dorf Blatten in der Schweiz ist menschenleer. Am Montag wurden die Einwohnerinnen und Einwohner vorsorglich evakuiert, denn Millionen Kubikmeter Geröll vom benachbarten Berg Kleines Nesthorn drohen, den Ort unter sich zu begraben. Auch am Freitag gibt es keine Entwarnung. Noch immer bricht Gestein vom Berg ab.
Herr Turowski, wie gefährlich ist die Lage in Blatten zurzeit?
Ich kann nur wiedergeben, was die Fachleute vor Ort sagen. Sie schätzen die instabile Masse zurzeit auf sechs Millionen Kubikmeter, davon sind bisher etwa zwei Millionen abgebrochen. Also ungefähr ein Drittel der Gesamtmasse. Das Gute ist: Es ist kein Bergsturz, bei dem es ein großes Ereignis gibt, sondern es gibt mehrere kleine. Das entschärft die Gefahrenlage. Worüber sich die Experten momentan große Sorgen machen, ist, dass das Gesteinsmaterial auf den Birchgletscher gefallen ist.

Jens Turowski leitet die Arbeitsgruppe „Physik der Erdoberflächenprozesse" am GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung.
Quelle: Privat
Was ist daran so besorgniserregend?
Durch das zusätzliche Gewicht hat sich die Bewegung an der Gletscherspitze um den Faktor vier bis fünf beschleunigt. Die Befürchtung ist, dass der Gletscher in der Folge heruntergeschoben wird, sodass viel Eis herunterfallen wird, das dann teilweise schmilzt. So könnte ein Strom aus Wasser, Eis und Geröll entstehen – ein sogenannter Murgang –, der das Tal und das Dorf erreichen könnte.
Was hätte das für Folgen?
Man kann sich diesen Murgang so vorstellen wie einen Ball, der eine steile Rampe herunterrollt und dabei immer schneller wird. Wird der Boden dann flacher, wird er nicht mehr beschleunigt und kommt allmählich zum Stillstand. So ähnlich wäre es beim Murgang auch – nur, dass sich der Schutt im Tal ablagern und ein Murgangkegel (zungenförmige Ablagerung, Anm. d. Red.) entstehen würde. Der Aufprall und die Schuttablagerung können Häuser und Infrastruktur zerstören oder dazu führen, dass Flüsse aufgestaut werden, es also zu Überschwemmungen kommt.
Fachleute sprechen von einem Bergsturz. Was ist damit gemeint?
Diese Bezeichnung ist eigentlich nichts anderes als eine Größenkategorisierung. Es meint lediglich, dass es sich um ein Ereignis handelt, bei dem mehr als eine Million Kubikmeter Gesteinsmaterial abbrechen und ins Tal hinabstürzen.
Neben dem Bergsturz gibt es noch andere Naturgefahren in den Bergen – darunter den Murgang, Steinschlag, Hangrutsch und Felssturz. Ein Murgang ist ein Strom aus Schlamm, Wasser und Gesteinsmaterial. „Murgänge können vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten erreichen und kilometerweit vorstoßen“, erklärt das Schweizer WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF. Dagegen setzt sich bei einem Steinschlag Gesteinsmaterial (also Steine mit einem Durchmesser von weniger als 50 Zentimetern) in Bewegung. Bei einem Hangrutsch löst sich der Erdboden vom Untergrund ab und rutscht bergab ins Tal. „Das kann ein jahrhundertelanger Prozess sein, kann aber auch spontan und schnell ablaufen“, so das SLF. Ein Felssturz ist wiederum der kleine Bruder des Bergsturzes: Hierbei stürzen Gestein und Felsen mit einem Gesamtvolumen von mindestens 100 Kubikmetern ins Tal.
Was löst ein solches Ereignis aus?
Zunächst einmal: Bergstürze sind relativ große und damit auch relativ seltene Ereignisse. Und sie sind vollkommen normal in Hochgebirgen. Das ist etwas, mit dem man immer wieder rechnen muss und das immer wieder auftreten kann und das in einem aktiven Gebirge auch regelmäßig auftretend wird. Aktives Gebirge meint, dass es tektonische Prozesse im Erdinneren gibt, die dafür sorgen, dass sich diese Gebirge heben und verformen.
Warum es jetzt im Einzelnen zu Bergstürzen kommt, hängt sehr stark von den lokalen Bedingungen ab. Wie sieht die Topografie dort aus? Wie steil ist das Gebirge? Welche Gesteinsarten sind vorhanden? Wie ist die Witterung? Was in jedem Fall passieren muss, ist eine Vorbereitungsphase. Dabei wird das Gestein gelockert und zerbrochen. Das kann teilweise Hunderte bis Tausende Jahre dauern. Und dann gibt es einen Auslöser, und der setzt dann diese teilweise zerbrochene Masse in Bewegung.
Was könnte beim Kleinen Nesthorn in Blatten der Auslöser gewesen sein?
Das ist noch unklar. Wahrscheinlich spielen mehrere Faktoren zusammen. Eine Vermutung ist, dass der tauende Permafrost den Bergsturz ausgelöst hat. Permafrost wirkt wie Kleber: Wenn Sie eine Felsspalte haben und da läuft Wasser rein und das friert an den Wänden fest, klebt es diese zusammen und dann gibt es keine Bewegung mehr im Gestein. Taut der Permafrost, kann sich das Gestein wieder bewegen.
Ein anderer Grund könnte das Schmelzwasser sein. Es gab in den vergangenen Tagen relativ warmes Wetter dort und es ist relativ viel Schnee geschmolzen. Das Schmelzwasser kann in Gesteinsspalten hineinlaufen und dort Druck ausüben.
Durch den Klimawandel werden schmelzender Schnee und auftauender Permafrost wahrscheinlicher. Könnte das zu mehr Bergstürzen führen?
Mir ist keine Studie bekannt, die das bestätigt. Der Klimawandel ist in jedem Fall kein direkter Auslöser, sondern wirkt eher als Treiber oder Beschleuniger. Zum Beispiel, indem er dafür sorgt, dass Gletscher schmelzen und sich folglich zurückziehen. Die Gletscher stützen normalerweise die Talwände – und wenn die Eismassen schmelzen, geht diese Stütze verloren. Das sorgt für Instabilität. Aber grundsätzlich ist es schwierig zu sagen, wie groß die Rolle ist, die der Klimawandel bei Bergstürzen spielt. Eben weil diese Ereignisse sehr selten sind, gibt es keine große Datenbasis.
Wenn es wirklich zu dem Bergsturz in Blatten kommt, wäre die Gefahr dann erst einmal gebannt? Oder ist mit weiteren Gesteinsabgängen zu rechnen?
Wenn es wirklich zu dem Bergsturz kommt, wäre die Gefahr fürs Erste vorüber. Es kann aber auch sein, dass eine Kettenreaktion in Gang gesetzt wird. Denn wenn die große Masse vom Berg abbricht, kann sich der untere Teil des Berges entspannen. Das ist wie bei einem Trampolin: Wenn man vom Trampolin heruntergeht, springt es zurück. Beim Berg dauert dieser Vorgang sehr viel länger. Und im Zuge dieser Entspannung des Berges kann es dann auch immer wieder zu kleineren oder größeren Ereignissen kommen. Da werden sich Spalten auftun und kleinere Abgänge wird es geben – das ist völlig normal. Aber das müsste man sich im Nachgang lokal genauer anschauen.

Kein Reinkommen: Der Ort Blatten in der Schweiz wurde vorsorglich evakuiert.
Quelle: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa
Wie kann man Bergstürzen wie in Blatten in Zukunft vorbeugen?
Das kann man nicht. Wie gesagt, das ist ein natürlicher Prozess, der sich nicht verhindern lässt. Was man machen kann, ist, dass man die Folgen reduziert.
Und wie?
Zum Beispiel, indem man die Menschen, die von dem Bergsturz betroffen wären, evakuiert. So wie es in Blatten geschehen ist. Zudem kann man Gefahrenpläne erarbeiten und die Gefahrengebiete kartieren, damit man weiß, wo es in Zukunft zu solchen Ereignissen kommen könnte.
Man kann auch Infrastrukturmaßnahmen treffen. Etwa Dämme, die Schäden durch Murengänge abwenden, oder Rückhaltebecken, in denen sich der abgetragene Schutt ablagern kann. Im Schweizer Ort Brienz, der auch von einem Bergsturz bedroht ist, hat man zum Beispiel einen Stollen gebaut, um das Wasser aus dem Gebiet abzuleiten. Aber solche Maßnahmen sind natürlich extrem aufwendig und mit hohen Kosten verbunden.
rnd