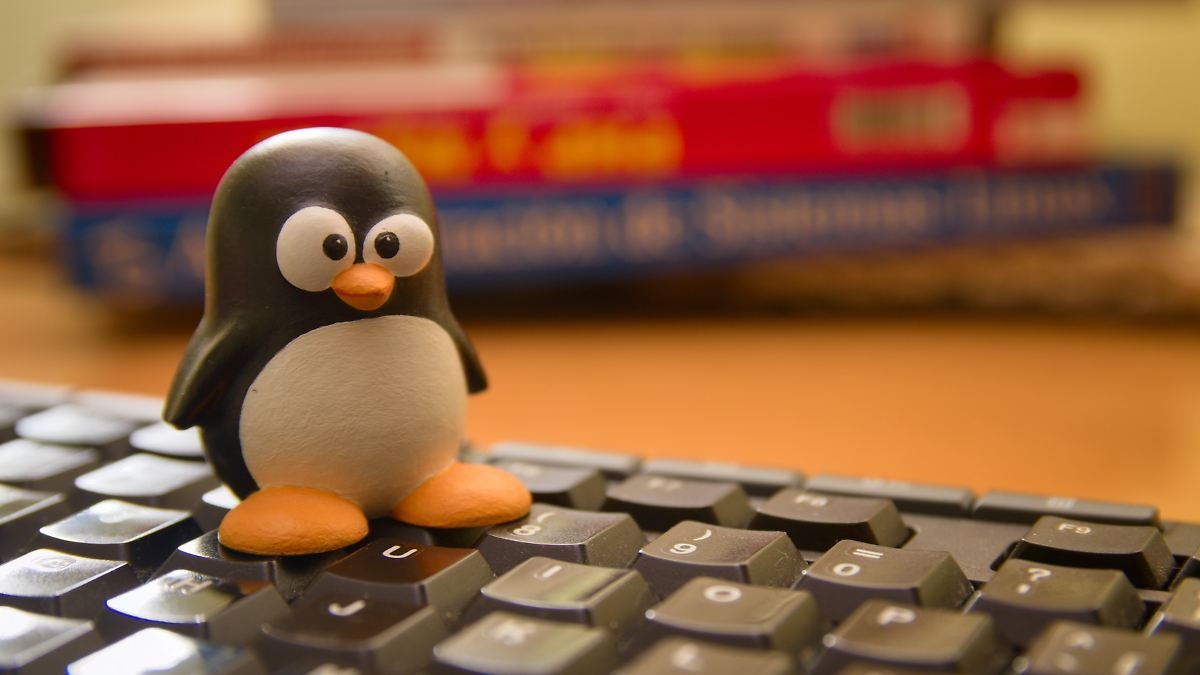Hirnschäden und Gewalt: Wann das Gehirn zur Gefahr wird

Erst erstach er seine Mutter und seine Frau, dann lief er Amok. Charles Whitman erschoss 14 Menschen und verletzte 32 weitere schwer, ehe er selbst von der Polizei getötet wurde. Bei seiner Obduktion stellte man fest, dass Whitman einen Hirntumor hatte. Sollte dies etwas mit seiner Tat zu tun gehabt haben? Beim deutschen Serienmörder Fritz Haarmann hingegen hielten es Forschende für möglich, dass seine Psyche wegen einer schweren Hirnhautentzündung gestört war. Beide Fälle liegen lange zurück. Whitman starb 1966, Haarmann wurde 1925 in Hannover hingerichtet. Heute gilt als gesichert: Hirnschäden können tatsächlich das Verhalten von Menschen verändern. Aber geht das wirklich so weit, dass sie dadurch gewalttätig werden?
Patrizia Thoma ist Leiterin des Neuropsychologischen Therapie Centrums der Ruhr-Universität Bochum. Verhaltensänderungen können nach verschiedenen Formen der Hirnschädigung auftreten, bestätigt sie. „Das kann nach einem Schädel-Hirn-Trauma der Fall sein, nach einem Schlaganfall, oder bei Erkrankungen wie Demenz oder einem Hirntumor. Die Verhaltensänderungen können entweder leichterer Art sein, oder aber so stark ausfallen, dass das Umfeld sie wie eine Änderung der Persönlichkeit wahrnimmt,“ sagt die Professorin. In der Regel sei eine Schädigung im Frontalhirn, also im vorderen Bereich des Gehirns, die Ursache. „Wesensänderungen, die nach Hirnschäden auftreten, sind jedoch ein facettenreiches Phänomen und sie müssen nicht immer impulsiver Natur sein“, erklärt die Professorin. „Das kann in alle Richtungen gehen. Manche, die vorher aufbrausend waren, sind vielleicht nachher lammfromm.“

Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Auf welche Art sich das Verhalten verändert, hänge dabei von der betroffenen Unterregion im Frontalhirn ab. Eine Schädigung des anterioren cingulären Cortex oder des dorsolateralen präfrontalen Cortex löse tendenziell eher das aus, was Neuropsychologen als Apathie-Syndrom beschreiben: Betroffene werden antriebsarm, kommen kaum noch aus dem Bett oder sitzen den ganzen Tag vor dem Fernseher.
Schäden im orbitofrontalen Cortex, einem Bereich über der Augenhöhle hingegen, lösen eher ein „antisoziales“, enthemmtes und aggressives Verhalten aus. Es könne dann zum Beispiel vorkommen, dass jemand schneller herumschreit. In Thomas Ambulanz berichtete eine Ehefrau, dass ihr Mann sie im Streit die Treppe hinunter geschubst habe. „Oft kommt es auch zu Problemen am Arbeitsplatz, bis zur Entlassung, weil jemand plötzlich seinen Chef beleidigt hat“, sagt sie.
Wie aber kommt es, dass Hirnschäden ein solches Verhalten auslösen? „Es kann sein, dass Menschen dadurch Impulse nicht mehr gut unterdrücken können“, erklärt Thoma. „Sie schaffen es aber wegen kognitiver Einschränkungen auch oft nicht mehr so gut, andere Menschen zu lesen und es fällt ihnen schwer, deren Verhalten einzuordnen. Sie reagieren dann auf falsche Annahmen. Das kann, muss aber nicht zur Aggression führen. Es kann auch dazu führen, dass sie sich zurückziehen.“ Bei einer Wesensänderung hin zum Impulsiven liege es jedenfalls nahe, dass im Extremfall auch gewalttätiges, also strafbares Verhalten begünstigt werden kann.
Der Zusammenhang zwischen einer Hirnschädigung und Verbrechen wurde auch bereits in Studien untersucht. Kanadische Forschende konnten 2017 zeigen, dass junge Menschen, die ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatten, besonders häufig straffällig wurden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie wegen einer schweren Straftat im Gefängnis landeten, war mehr als doppelt so groß wie in einer Vergleichsgruppe.
Allerdings gibt es bei solchen Studien ein Problem: Sie können nicht sauber trennen, inwieweit die Hirnschäden ein aggressives Verhalten ausgelöst hatten oder durch impulsives Verhalten verursacht wurden – zum Beispiel, weil impulsive Personen öfter in Unfälle oder Schlägereien verwickelt sind. Es kann auch beides zutreffen – die Zahlen werden aber dadurch verzerrt.
In jedem Fall passen die Wesensänderungen, die nach Hirnschäden häufiger beobachtet werden, auch nicht zu jeder Art von Verbrechen. Zu Taten durch Kontrollverlust vielleicht schon. Aber nicht zu klassischen, geplanten kriminellen Machenschaften. „Schon allein deshalb, weil Betroffene vor allem reaktiv und kaum planerisch handeln und oft auch kognitiv eingeschränkt sind“, so Thoma. Grausame, kalt kalkulierende Psychopathen, die einen gewissen Anteil der Gewaltverbrecher ausmachen, würden emotionale Kälte zeigen und sich eher kontrolliert als impulsiv benehmen.
Auch bei ihnen werden übrigens oft angeborene Auffälligkeiten im Gehirn beobachtet, die sich aber von denen durch Hirnverletzungen unterscheiden. „Es kann sein, dass ihr präfrontaler Cortex nicht mehr so gut in der Lage ist, unangemessene Handlungen zu hemmen. Er kann aber auch relativ unauffällig sein. Dafür kann man oft eine Unteraktivität im limbischen System feststellen - dadurch wird man weniger mitfühlend mit anderen“, so Thoma.
Was aber bedeutet all das für Menschen, bei denen es nach einem Schlaganfall, einer Hirnoperation oder einem Schädel-Hirn-Trauma zu einer Wesensveränderung kommt? „Wenn dadurch ein Leidensdruck besteht, ergibt es Sinn, das auch therapeutisch anzugehen“, sagt Thoma. „Dabei ist es zunächst wichtig, zu prüfen, was tatsächlich der Grund ist. Ist es vielleicht eher Frustration über die gesundheitliche Einschränkung, die zu erhöhter Reizbarkeit führt, oder gibt es wirklich eine organische Ursache für eine mangelnde Impulskontrolle oder fehlende soziale Kompetenz?“ Schließlich können Krankheiten und Unfälle auch eine starke psychologische Belastung sein und dadurch die Stimmung und das Verhalten beeinflussen.
Unter Thomas Leitung wurde an der Ruhr-Universität Bochum ein Programm speziell für Menschen entwickelt, bei denen sich die soziale Kompetenz durch eine Hirnschädigung verschlechtert hat. „Wir geben ihnen dann Strategien an die Hand, um neu zu lernen, Menschen zu lesen“, erklärt sie.
Bei Patientinnen und Patienten, die Probleme mit der Impulskontrolle entwickelt haben, sollte man hingegen nach den häufigsten Auslösern suchen: Werden sie vielleicht immer dann aggressiv, wenn sie etwas nicht mehr machen können, was sie vorher konnten? „Außerdem kann man sie darin schulen, eine wachsende Anspannung bei sich zu bemerken, und dann vielleicht rechtzeitig rauszugehen, aus bestimmten Situationen und ihnen Entspannungstechniken beizubringen“, sagt Thoma.
Die Basis für die therapeutische Arbeit sei es, dass jemand selbst sein aggressives Verhalten erkennt und ändern möchte. „Wenn es keine Einsicht gibt, und jemand vielleicht kognitiv durch die Hirnschäden zu stark beeinträchtigt ist, fruchtet das alles weniger“, so die Professorin. „Dann kann nur versucht werden, die Auslöser für das aggressive Verhalten zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass die Personen in ihrer Wut niemandem schaden können. Manchmal ist die Unterbringung in einem Heim erforderlich.“
Dass eine Hirnschädigung das Wesen so stark verwandelt, dass jemand nur dadurch zum Mörder wird, hält die Expertin jedenfalls für extrem unwahrscheinlich. Dafür gebe es nie nur eine Ursache. Was die prominenten Beispiele angehe, sei zu wenig bekannt. „Es wäre zum Beispiel spannend gewesen, ab wann sich bei Whitman der Tumor entwickelt hat und ob es dadurch tatsächlich zur Persönlichkeitsänderung kam“, sagt sie. In jedem Fall hatte Whitman in der Kindheit schweren Missbrauch erlebt – ein weiterer Risikofaktor, um zum Täter zu werden. „Vielleicht hat er auch schon vorher eine starke Neigung zu Aggressionen gehabt“, sagt Thoma. „Dann könne es sein, dass ihn der Tumor nur noch zusätzlich enthemmt hat.“
rnd