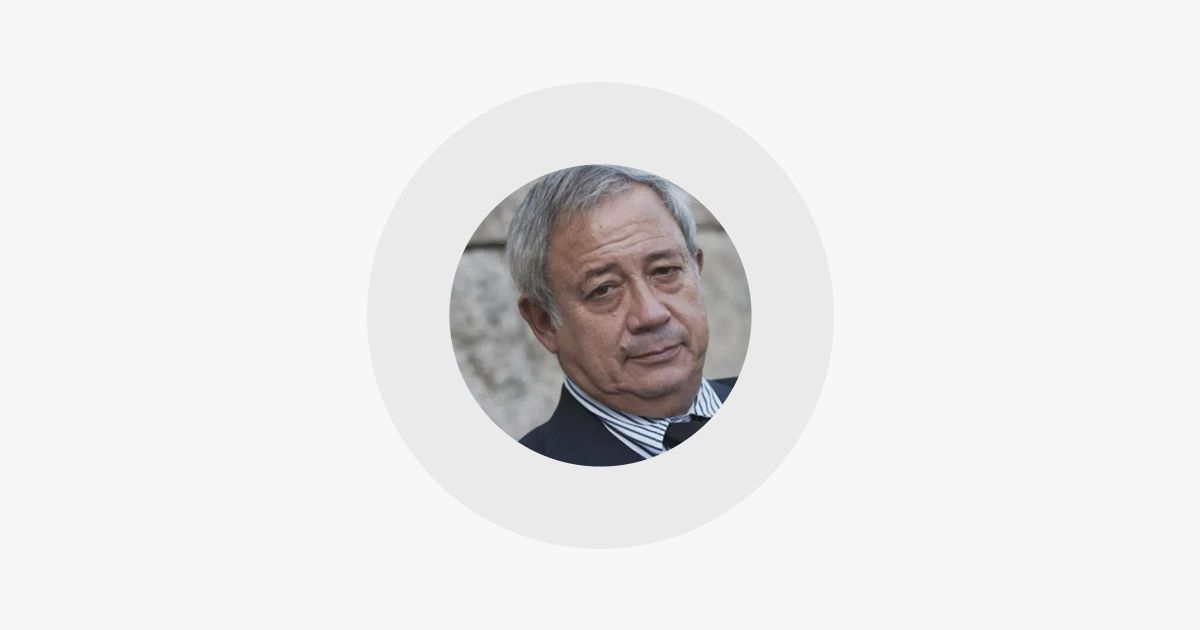Zwei Anmerkungen zu Reparaturen.
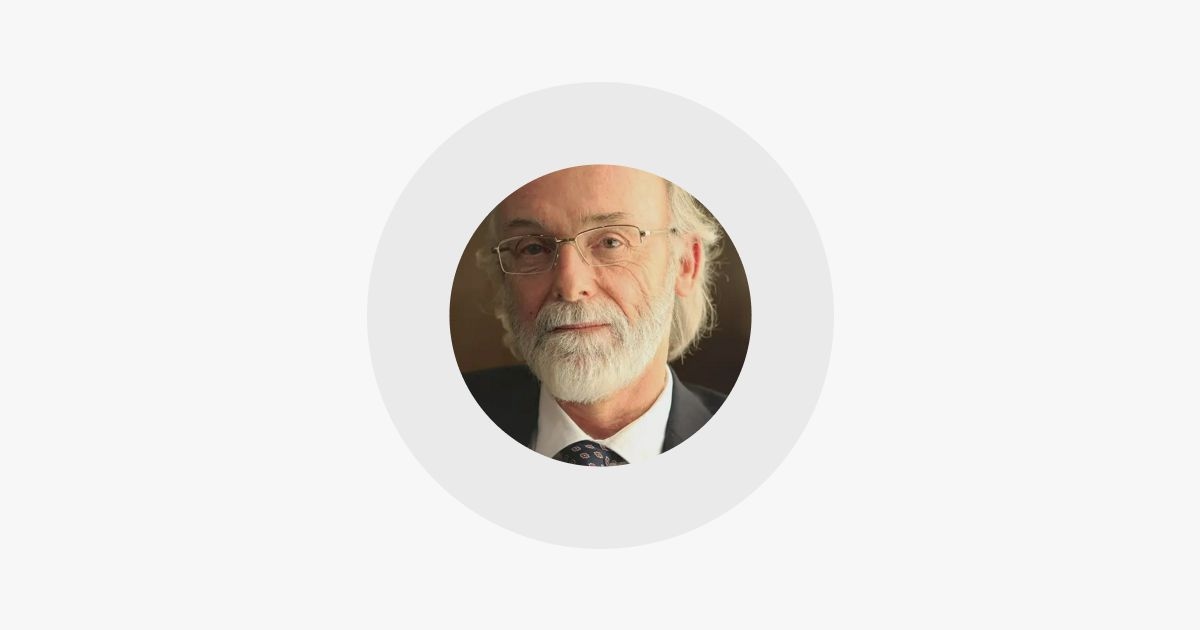
Letzten Monat erschien die vierte Sammlung meiner Chroniken zu Themen der Kolonialgeschichte, die ich seit 2017 veröffentliche. Wie die vorherigen Sammlungen wurde auch diese von Guerra e Paz herausgegeben und trägt den Titel „Reparationen und andere historische Bußen“ . Das Cover zeigt Seh-Dong-Hong-Beh, eine Kommandantin der Amazonen (Kriegerinnen von Dahomey), die den abgetrennten Kopf eines schwarzen Mannes hält. Die Zeichnung stammt von Frederick E. Forbes (siehe Abbildung).

Forbes, ein Offizier der Royal Navy, besuchte Mitte des 19. Jahrhunderts das Königreich Dahomey, lebte dort viele Monate und hinterließ uns in seinen 1851 veröffentlichten Memoiren einen Bericht über seinen Aufenthalt sowie zahlreiche Illustrationen der Bewohner des afrikanischen Königreichs. Die Zeitschrift „Expresso“ erwähnte meine Sammlung freundlicherweise in ihrer Bücherrubrik, wofür ich sehr dankbar bin. Überraschenderweise wurde jedoch, anstatt wie üblich das Titelbild abzubilden, eine Fotografie von Eisenfesseln und anderen Instrumenten verwendet, die vermutlich von Europäern zur Fesselung von Sklaven eingesetzt wurden. Mit anderen Worten: Das Bild afrikanischer Brutalität wurde durch eine Anspielung auf europäische Brutalität ersetzt. War es lediglich eine Frage der Seitenzahl oder gab es eine politisch korrekte Zurückhaltung, die Gewalt offenzulegen, die Afrikaner einander antaten? Ich kann es nicht sagen und möchte auch nicht über die Absichten spekulieren, aber es ist gewiss ungewöhnlich…
Abgesehen von den Bildern stellt Expresso fest, dass Reparationen „eines der wichtigsten Diskussionsthemen der Gegenwart“ seien und behauptet zu Recht, ich sei dagegen. Warum aber bin ich gegen Reparationen für Menschen, die behaupten, Nachkommen von Sklaven zu sein? Aus verschiedenen Gründen, die ich im Laufe der Zeit erläutert habe, einige davon finden sich in dieser Sammlung, und vor allem, weil ich glaube, dass die notwendigen Reparationen bereits im 19. Jahrhundert geleistet wurden, als die westlichen Völker, insbesondere die Briten, den transatlantischen Sklavenhandel verboten und unterdrückten und die Sklaverei beendeten. Ich habe diese Position schriftlich und live verteidigt, in einer Debatte in der Sendung „É ou Não É?“ auf RTP, was die „Woke “-Szene sehr verärgerte. Einige von ihnen reagierten umgehend. Die Kolumnistin Luísa Semedo von Público, die offensichtlich dazu neigt, endlos über Dinge zu reden, von denen sie keine Ahnung hat, zog sogar eine merkwürdige Parallele. Sie schrieb Folgendes: „Und wie kann er (João Pedro Marques) erwarten, dass wir ihn ernst nehmen, wenn er heute in einer Fernsehdebatte mit solcher Überzeugung so absonderliche Argumente vorbringt wie: ‚Wir haben das Verbrechen der Sklaverei bereits wiedergutgemacht, weil wir sie beendet haben und weil es uns so viel gekostet hat, sie zu beenden‘, was wir – und der Vergleich stammt von Luísa Semedo – so zusammenfassen können: ‚Wenn ein Mann aufhört, eine Frau zu schlagen, ist das bereits Wiedergutmachung für das Verbrechen, und die Frau muss nur dankbar sein, insbesondere weil es den Mann so viel gekostet hat, damit aufzuhören. Wenn es heißt, man könne die Vergangenheit nicht mit den Augen der Gegenwart betrachten … Welche Augen hat JPM dann?‘“
Nun, Luisa Semedo, das sind die Augen einer Person, die nicht durch ideologische Scheuklappen daran gehindert wird, sowohl nach links als auch nach rechts zu blicken; jemand, der – Gott sei Dank – nicht an Doppeltsehen leidet, wodurch er Bilder wahrnimmt, die die Probleme der Abschaffungsbewegung mit Geschlechterfragen verkomplizieren und vervielfachen – nein, ich teile die Intersektionalitäts-Agenda nicht –; und vor allem die Augen einer Person, die sich mit Geschichte auskennt. Und genau aus diesem letzten Grund sage ich Ihnen, dass die Analogie mit einem Mann, der eine Frau schlägt, nur von jemandem stammen kann, der nicht die geringste Ahnung hat, wovon er spricht. Es ist eine nutzlose Analogie, weil die Dinge nicht so abgelaufen sind. Die westlichen Länder hörten nicht einfach nur auf, eine verwerfliche und verurteilte Handlung auszuüben, das heißt, sie hörten nicht einfach nur auf zu schlagen – um Luisa Semedos unglücklichen Vergleich aufzugreifen –, sie versuchten auch, andere, nämlich viele afrikanische Häuptlinge und Könige, daran zu hindern, dies weiterhin zu tun. Ja, es gab Länder – Dänemark, die Niederlande –, die ihren Sklavenhandel einfach beendeten. Doch Großbritannien, Frankreich, Portugal und andere westliche Länder schafften diese Praxis nicht einfach ab, sondern versuchten auch, sie einzudämmen. Verbot und Eindämmung sind nicht dasselbe, Luisa Semedo. Um den transatlantischen Sklavenhandel und auch den Handel im Indischen Ozean zu unterbinden, waren Entschädigungszahlungen, militärische Interventionen an Land und der Einsatz von Kriegsschiffen zur Überwachung dieser Ozeane notwendig.
Es war ein über Jahrzehnte andauerndes Unterfangen, dessen Kosten immens hoch waren. Großbritannien beispielsweise gab dafür rund 12 Millionen Pfund aus. Portugal, dessen Kreuzfahrtschiffe später als die britischen in Betrieb gingen, hatte bis 1860, also in den ersten zwanzig Jahren seiner Bekämpfungsmaßnahmen, rund 4 Millionen Contos ausgegeben – eine enorme Summe angesichts seiner damaligen finanziellen Mittel. Hinzu kommen die Menschenleben. Die Küste Afrikas war aufgrund tropischer Fiebererkrankungen (Malaria, Gelbfieber) und anderer Krankheiten äußerst gefährlich. Sie war so tödlich, dass Sierra Leone und analog dazu andere Küstenabschnitte als „Grab der Europäer“ – oder im Englischen als „ Grab des weißen Mannes “ – bekannt wurden, ein Ausdruck, der 1819 von dem Portugiesen César de Figanière y Morão geprägt wurde. Ich möchte drei oder vier Beispiele nennen: 1841 starben 25 der 140 Mann Besatzung der Wolverine an der Küste Biafras; Von den 50 Seeleuten, die den Pongos-Fluss befuhren, starben 46 innerhalb von sechs Tagen; laut britischen Statistiken war die Sterblichkeit durch Krankheiten auf Schiffen, die in Afrika im Einsatz waren, fünfmal höher als auf Schiffen, die in den Meeren Europas kreuzten; und jeder, der den Roman Eugénio liest, der Mitte des 19. Jahrhunderts von Marineoffizier Francisco Maria Bordalo geschrieben wurde, wird sofort das Opfer und das extrem hohe Lebensrisiko verstehen, das der Dienst auf der Marinestation in Luanda mit sich brachte.
Was war das praktische Ergebnis dieser Anstrengungen und Risiken? Die Briten beschlagnahmten 1.575 Sklavenschiffe, die Franzosen 214, die Portugiesen 168, die Amerikaner 68 usw. Die Bekämpfung des Sklavenhandels erforderte den Einsatz erheblicher militärischer und finanzieller Ressourcen und kostete Menschenleben, nicht nur durch Krankheiten, sondern auch im Kampf gegen die Sklavenhändler. Portugal beteiligte sich an dieser Bekämpfung. Ich habe diesen Aspekt der portugiesischen Geschichte in Afrika 1999 in einem mittlerweile vergriffenen Werk behandelt. Glücklicherweise gibt es jedoch für alle Interessierten ein gutes und aktuelleres Buch, das den Einsatz der portugiesischen Marine im Kampf gegen den Sklavenhandel detailliert beschreibt.
Kurz gesagt, ist im Kontext dieser Ausführungen vor allem hervorzuheben, dass westliche Länder – darunter auch Portugal – im Hinblick auf den afrikanischen Sklavenhandel keine rein passive Haltung einnahmen, indem sie lediglich „die Prügel beendeten“, wie es die Kolumnistin Luísa Semedo und andere Vertreter der sogenannten „Wokeness“ fälschlicherweise darstellen. Und was das Ende der Sklaverei betrifft, genügt ein Blick auf den Amerikanischen Bürgerkrieg, der über 600.000 Menschenleben forderte, um zu verstehen, dass auch dort keine Passivität herrschte; es ging nicht einfach nur darum, „die Prügel zu beenden“. Daher sind keine weiteren Wiedergutmachungszahlungen nötig. Das Ende des Sklavenhandels und der Sklaverei stellt eine ausreichende Wiedergutmachung dar, und diese Wiedergutmachung wurde im 19. Jahrhundert, vor etwa 200 Jahren, geleistet.
observador